Wir verwenden Cookies
Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, kann Ihre Systemsoftware Informationen in Form von Cookies oder anderen Technologien von uns und unseren Partnern abrufen oder speichern, um z.B. die gewünschte Funktion der Website zu gewährleisten.
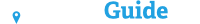















Das Dünnbier wurde aber in größeren Mengen von allen Bevölkerungsschichten verzehrt: Als Energiequelle und eine sinnvolle Alternative zu dem meist verdreckten Brunnenwasser.
Das meiste Bier war obergärig, denn diese Hefen arbeiten bei milden Temperaturen recht gut; für untergärige Sorten brauchte man Kühlung – und die gab es früher nur regelmäßig im Winter.
Durch die Erfindung der Kühlmaschine durch Carl von Linde wurde das dann anders. Und die Forschungsergebnisse von Louis Pasteur waren ebenfalls ein Meilenstein. Seine Erkenntnisse machten die als unberechenbar geltenden Hefen erst beherrschbar. Zusammen mit verbesserter Hygiene konnte das Getränk so werden, wie wir es heute kennen.
Besonders beliebt wurde dabei das untergärige Bier aus Pilsen. Bald nannten sich viele Produkte nicht nur in Deutschland Pilsner, Pilsener oder auch nur Pils. Dabei ist diese Brauart eigentlich aus der Bayerischen Brauart entstanden.
Auch in Köln wollte kaum noch jemand das alte einheimische „Gesöff“ trinken. So wurde auch hier kaum noch obergäriges Bier gebraut. Aber gegen die großen Hersteller (wie zum Beispiel Dortmunder Biere) gerieten die Kölner Brauer ins Hintertreffen.
Da machten sie einige Brauer Gedanken und setzten auf die Heimatverbundenheit der Rheinländer.
Für die Gattung "Kölsch" hat sich dabei Hans Sion besonders verdient gemacht. Ab etwa 1900 wurde die Sortenbezeichnung "Kölsch" bereits verwendet. Aber erst nach dem 2. Weltkrieg begann der „Siegeszug“ (1945 etwa 10 Prozent Marktanteil – 1985 etwa 90 Prozent).
Helles obergäriges Bier darf heute nur noch "Kölsch" heißen, wenn es im Stadtgebiet von Köln produziert wird; allerdings durften alte Marken bzw. Firmen ihren Namen behalten.
So wird "Kölsch" zum Beispiel noch in Wiehl oder Brühl gebraut. Einige Produzenten aus dem Rheinland haben auch einen Rechtsstreit mit dem Kölner Brauerei-Verband vermieden. Sie haben den Namen gewechselt, lassen brauen (Lohnsud) oder sind einfach nach Köln gezogen. Lüpges Kölsch aus Königshoven zum Beispiel wurde vom Markt genommen. Cramer Kölsch aus Wollersheim nannte sich Cramer Obergärig. Küppers aus Wuppertal verlegte den Brauort einfach in die Stadt.
(Fast) alle Fragen regelt heute die Kölsch-Konvention http://koelner-brauerei-verband.de/koelsch-konvention.html (seit 1985): Das Glas (Kölschstange) und das Aussehen und der Geschmack (hell, klar, hoch vergoren, mittel bis stark verhopft, feinperlig, haltbar, 4,8 bis 5 % Alkohol) sind die bekanntesten Merkmale.
Umfassende weitere Informationen gibt es bei http://www.koelsch-net.de.
Programm
Das Thema „Kölsch“ mit all seinen Facetten ist eines meiner Hobbys. Ich sammle Informationen über alle Braustätten und besitze einige der traditionellen Stangen.
Da konnte ich das Angebot „Kölsch pur – eine exklusive YouDinner-Tour durch Kölns Brauereigeschichte“ einfach nicht auslassen. Angekündigt wurden:
- Einblicke in die Braukeller
- Verkostung verschiedener Kölsch-Varianten
- Fakten und Anekdoten rund ums Kölsch
- spannendes Bierwissen von A–Z vom YouDinner-Kölsch-Experten
- herzhafte „Kölsche Tapas“ im Brauhaus Päffgen
Wir haben uns am klassischen Treffpunkt vor dem Dom an der Kreuzblume versammelt.
Unserer Führer erzählte natürlich nicht nur über Bier, sondern auch über Köln allgemein und am Anfang kurz etwas zum Dom; schließlich standen wir vor dem imposanten Bauwerk.
Dann gingen wir zum vielleicht bekanntesten Brauhaus: dem Früh am Dom. Mit allen Räumen und Ecken zusammen können hier fast 2000 Menschen versorgt werden.
Wir setzten uns an einen freien Tisch in der Nähe eines wichtigen Teiles einer kölschen Gaststätte: dem Beichtstuhl, es hat nichts mit der katholischen Kirche zu tun, es ist ein kleines Büro. Hier sitzt heute – nicht mehr immer – aber früher jederzeit der Chef – der Baas. Von diesem kleinen Ort hatte er volle Sicht auf sein Brauhaus.
Der Köbes (Jakob) – so heißen die Kellner in Köln – ist für den Gast die wichtigste Person. Bekannt sind sie für ihre coolen Sprüche. „Ein Wasser, bitte“, sagt ein Gast. Da kommt natürlich eine Antwort wie: „Sin mer hee em Schwemmbadd oder wat?“ – Aber in vielen Kneipen sind heute Mitarbeiter, die gar nicht mehr die Sprache Kölsch beherrschen.
Der dritte Beruf im Brauhaus ist der Zappes, der im Hintergrund immer für volle Gläser sorgt. Und in vielen Lokalen sitzt auch eine Klofrau vor dem stillen Ort. Ich begrüße das durchaus, denn nicht alle Gäste benehmen sich dort angemessen. Dann bin ich froh, dass Seife und Handtücher da sind.
Nach der ersten Erfrischung ging es dann weiter. Unser Führer war für Vorschläge und Fragen offen. Mein Lieblingslokal – die Schreckenskammer bei Sankt Ursula - hatte Betriebsferien, sonst hätte der Weg auch dorthin führen können.
So gingen wir Richtung Alter Markt. Hier stehen die Kneipen so dicht, wie überall in der Altstadt. Wir sahen uns von außen das Peters Brauhaus an. Das Bier wurde früher in Monheim gebraut, heute bei Gilden in Mülheim. Dann noch das schöne alte Gaffel-Haus, das heute Zum Prinzen heißt und an Poldi erinnern soll, der nebenan auch ein Geschäft unterhält. Auch Sünner und Sion haben hier ihre Stationen, um nur einige zu nennen.
Unser Weg führte dann Richtung Heumarkt. Hier liegen weitere bekannte Brauhäuser. Zum Beispiel die Malzmühle – auch ein Brauhaus, das mir sehr gefällt. Bill Clinton war hier Gast beim G8, weil er keinen Platz bei Lommerzheim in Deutz bekommen haben soll.
Wir gingen aber ins „Gilden im Zims“. Das Lokal habe ich bisher noch nie besucht. Wir stiegen in einen alten aber gut renovierten Kellerraum herab. Dort probierten wir das Gilden Kölsch. Die Brauerei gehört heute zum „Haus Kölscher Brautradition“. Diese Gruppe gehört zu Radeberger und damit zum Oetker-Konzern.
Als nächstes Gasthaus besuchten wir die Pfaffen-Brauerei Max Päffgen am Heumarkt. Diese Gastronomie ist ein Paradebeispiel für Streit unter Brüdern. Früher haben die beiden das Bier nur vom Stammhaus in der Friesenstraße bezogen. Dann wollte Max selber brauen. Das konnte mit Prozessen verhindert werden. Aber am Ende braute dieser Teil der Familie doch ein eigenes Bier, aber außerhalb von Köln und daher darf das Bier natürlich nicht Kölsch heißen, sondern nur Pfaffen Bier. Aber in der direkten Nachbarschaft gibt es zwei Lokale, die das „echte“ Päffgen Kölsch vertreiben.
Das Bier schmeckte tatsächlich auch nicht wie die anderen Kölsch-Sorten an diesem Tag. Es erinnerte mehr an ein Pale Ale: etwas süßer und malziger eben.
Damit wir dann das Traditionsbrauhaus in der Friesenstraße rechtzeitig im Zeitrahmen erreichen konnten, fuhren wir mit der Linie 5 vom Heumarkt bis zum Friesenplatz. Diese U-Bahn-Station ist eine riesige protzige gewaltige Haltestelle, die aber nur von einer Bahn angefahren wird – da sind doch die Steuergelder gut angelegt. Es steigen zwar kaum Fahrgäste ein oder aus, aber man könnte Tausende Menschen dort unterbringen oder Feste feiern – Platz ist genug und auch in einer ordentlichen Tiefe. Ich kannte diese Station noch gar nicht, denn sie liegt etwas weiter als die übrigen ober- und unterirdischen Haltestellen dort.
Das Päffgen ist ein herrlicher Bau. Neben dem Brauhaus gibt es auch einen schönen Biergarten. Auch das Bier wird noch dort gebraut.
Der Köbes brachte uns frisches Kölsch und Mettbrötchen sowie einen Halven Hahn. Hierbei handelt es sich nicht um ein Hähnchen, sondern ein Roggenbrötchen mit Butter und dicker Scheibe mittelaltem Gouda. Das Röggelchen muss man selber aufschneiden, die Butter aufs Brot schmieren und den Rand vom Käse schneiden. Reibekuchen oder Himmel und Äd gehören auch zu den typischen kölschen Gerichten.
Fazit
5 – unbedingt wieder. In einer Gruppe mit Youdies und einem Führer macht der Besuch von Brauhäusern noch mehr Spaß. Auch wenn ich schon viel zu dem Thema selber weiß, kommen neue Anekdoten dazu und man lernt Menschen kennen, die auch Freude am Thema haben.
(1 – sicher nicht wieder, 2 – kaum wieder, 3 – wenn es sich ergibt wieder, 4 – gerne wieder, 5 – unbedingt wieder – nach „Kuechenreise“)
Datum des Besuchs: 20.07.2017 – am späten Nachmittag bis zum frühen Abend.